Jahresrückblick 2019: Die 25 Lieblingsalben von Jonah Lara

In seinem Jahresrückblick resümiert unser Volontär Jonah Lara, wie sich alte Helden zu neuen Höhen gespielt haben, und entdeckt dazu noch ein völlig neues Genre.
Dieses Jahr ist das erste, in dem ich einen Jahresrückblick ziehen muss. Dementsprechend schwer war es für mich, die hier versammelten Alben zusammenzutragen: Denn 25 Alben zu finden, die ich mittels einer Liste auf ewig mit mir und dem Jahr 2019 in Verbindung bringen will – das ist schon nicht ohne. Zumal ich mit dem intensiven Verfolgen aktueller Veröffentlichungen erst mit Beginn meines Volontariats im August angefangen habe. Trotzdem: Unter diese 25 Alben setze ich ohne zu zweifeln mein Gütesiegel.

25: Garrett T. Capps All Right, All Night
Garrett hat grad nochmal so Glück gehabt, dass Michi auf 25 Alben bestanden hat. Ich wäre eigentlich auch für schlaffe zehn zu haben gewesen, und die Ausweitung zwingt mich jetzt, objektiv durchwachsene – aber eben doch liebgewonnene – Alben wie dieses auf die Liste zu setzen. Wirklich berauschend finde ich nur etwas mehr als die Hälfte von „All Right, All Night“. Die ist aber so gut, dass Garrett sich trotzdem genug guten Willen für einen Platz im Jahresrückblick verdient hat.

24: Cattle Decapitation Death Atlas
Ähnlich ambivalent stehe ich Cattle Decapitations „Death Atlas“ gegenüber. Die amerikanischen Deathgrind-Größen liefern ein sandgestrahltes, überproduziertes Doppelkonzeptalbum-Monster ab, das in seinen Extremen und der kopflastigen Überfrachtung den perfekten Soundtrack zum spätkapitalistischen Albtraum des Klimawandels liefert, dem sich Cattle Decapitation textlich widmen. Dabei durchziehen sie ihren stacheligen Deathgrind noch mehr mit melodischen Black-Metal-Anleihen und Sänger Travis Ryan weitet die ohnehin schon beeindruckende Dynamik seiner Vocals noch weiter aus. In seiner Länge und der Brutalität der meisten Songs grenzt „Death Atlas“ zu hören zwar ab und zu an Arbeit, ist aber schlussendlich belohnend.

23: Swans Leaving Meaning
Das erste Album von Swans ohne festes Line-up wirkt in etwa so, als sezierten sie ihre eigene Bandgeschichte. Schicht um Schicht schälen Michael Gira und seine Mitmusiker*innen vom Jam-fokussierten Sound der Reunion-Trilogie, und dabei entdecken sie den Sound von Gira-Nebenprojekten wie den Angels of Light ebenso wie vergangene Swans-Inkarnationen als Sedimente. Wirklich nach vorne zeigt dabei eigentlich kein Song, außer dem großartigen taumelnden Schlussstück „My Phantom Limb“ und dem Rätselhaften „The Nub“.

22: Kishi Bashi Omoiyari
Kaoru Ishibashi (Ex-Of-Montreal) hat sogar einen begleitenden Dokumentarfilm zu seinem historischen Konzeptalbum über die Internierung japanischstämmiger US-Bürger*innen im Zweiten Weltkrieg gedreht. Doch trotz des ambitionierten Konzepts ist das wunderbare an Omoiyari gerade seine leichte, unmittelbare und emotional zugängliche Schönheit.
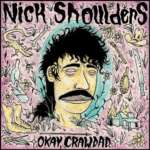
21: Nick Shoulders Okay, Crawdad!
Trüge dieser Jahresrückblick den Titel „Die 25 sympathischsten Künstler*innen für Jonah Lara“ wäre Nick Shoulders mit ziemlicher Sicherheit auf Platz 1, obwohl das bei Konkurrenz wie Cattle Decapitation und Michael Gira zumindest klanglich eh kein Kunststück wäre. Trotzdem: Sein Charme ist nur ein Grund dafür, warum ich sein Debütalbum trotz der kurzen Zeitspanne seit der Veröffentlichung auf meiner Liste unterbringe. Inspiriertes Songwriting, eine bereits vollständig geformte künstlerische Identität und seine goldene Stimme liefern den Rest.

20: Departure Chandelier Antichrist Rise to Power
Ein ziemlicher Glücksgriff: Ich habe das erste Album dieser angeblichen Black-Metal-Supergroup aus Québec irgendwann mal durch eine meiner unzähligen Bandcamp-Newsletter-Abonnements vorgeschlagen bekommen. Um sagen zu können, ob es sich bei Departure Chandelier tatsächlich um eine Supergroup handelt, bin ich nicht genug im Metal-Underground Québecs unterwegs. Aber ihre Mischung aus klassischem Black Metal, Dungeon Synth und Garage-Rock-Unmittelbarkeit hat mich vom ersten Hören an in den Bann gezogen.

19: Earth Full upon her burning Lips
Zuletzt habe ich mir große Sorgen um Dylan Carlson gemacht. Seine Band Earth war richtungsweisend für große Teile meiner musikalischen Entwicklung, aber das letzte Earth-Album „Primitive and deadly“ und der größte Teile seiner Soloprojekte unter dem Namen Drcarlsonalbion sind ziemlich spurlos an mir vorüber gezogen. Umso glücklicher war ich, als ich Full upon her burning Lips das erste Mal gehört habe: Nicht nur war das Album gut, eines der besten der späteren Jahre, Carlson und seine Schlagzeugerin Adrienne Davies haben diese Großtat sogar ohne Gimmicks vollbracht, nur mit fokussiertem Songwriting und einem Ohr für subtile Kniffe in der Produktion.

18: Esther Rose You made it this far
Auf ihrem zweiten Soloalbum macht die Singer/Songwriterin aus New Orleans einen großen Schritt Richtung Pop. Die helle Produktion, die offenkundigen Texte und der Mut zu mehr Melodieseligkeit tun ihr gut: „You made it this far“ ist Nashville-Wohlfühl-Countrypop par excellence – obwohl es Rose auch nicht an Wehmut mangelt. Doch das Album balanciert seine emotionalen Höhen („Sex and Magic“, „Only loving you“ und „Handyman“, um nur ein paar zu nennen) perfekt gegen die melancholischen Momente, wie das Meisterstück „Blame it on the Moon“.

17: Bonnie „Prince“ Billy I made a Place
„I made a Place“ ist mit Sicherheit Will Oldhams ambivalentestes Album. In der begleitenden Pressemitteilung sprach er über die „Atomisierung der Produktion und Rezeption von Musik“, weswegen „I made a Place“ das erste Album mit neuem Material nach einer achtjährigen Pause ist. Leicht macht es uns Oldham bewusst nicht: Obwohl „I made a Place“ über weiter Strecken lieblich klingt, sind seine Texte hintergründig und rätselhaft, durchzogen von kryptischem Humor und doppelten Böden.

16: Sunn O))) Life Metal
Ähnlich wie Earth haben auch Sunn O))) sich dieses Jahr zurück zur alten Form gespielt. Ich war drauf und dran, „Life Metal“ als ihr bisher bestes Album abzuspeichern: Ein makellos produzierter, hell schillernder Klangraum, der die Stärken des Duos wie kein Album bisher zu bündeln vermochte. Jenseitig, überlebensgroß, tröstend und berührend.

15: Chelsea Wolfe Birth of Violence
Die letzten Jahre über mag man Chelsea Wolfe vor allem mit Doom- und Noiseinformiertem Gothrock in Verbindung gebracht haben. Ihr mittlerweile sechstes Album Birth of Violence führt Wolfe zurück zu ihren Wurzeln im Folk und setzt ihre diversen Einflüsse als hochgradig wirkkräftige Akzente ein. „Birth of Violence“ ist ihre bisher stärkste Leistung in Sachen Songwriting und das Album, auf dem sie ihre eigene Ästhetik endgültig meistert: Für mich ab sofort die Platte, mit der ich Uninitiierte an das Œuvre dieser großartigen, vielfältigen Musikerin heranführen werde.

14: Girl Band The Talkies
Ich habe Girl Band zuletzt wirklich bewusst mit der tollen Post-Hardcore-Single „Lawman“ gehört und dann schmächlicherweise ihr Debütalbum vernachlässigt. Als das Quartett aus Irland dann nach vier Jahren Pause zurückkam, konnte mich nichts auf dieses Album vorbereiten. Ein Sound, der mehr mit Noise zu tun hat als mit den linearen Songs, mit denen ich sie zuvor in Verbindung gebracht habe. Girl Band entlocken der klassischen Bandbesetzung Klänge, deren Referenzpunkte ich zwar vage ausmachen kann, die ich aber so noch nie gehört zu haben meine.

13: Lambchop This (is what i wanted to tell you)
Ganz anders ist es mit Lambchop, die zwar eine ähnlich überraschende Platte gemacht haben, von der ich aber beinahe vergessen hätte, dass sie 2019 erschienen ist. Das liegt mitnichten daran, dass ihre weitere Erkundung von Autotune und elektronischen Klängen nicht aufregend wäre (FLOTUS war zuletzt zwar auch geautotuned, aber noch viel organischer), sondern daran, dass diese Platte trotz des kleinen Skandals so warm und vertraut klingt. „This“ fühlt sich so sehr nach Zuhause an, dass man beinahe meinen könnte, man kenne dieses Album schon ewig.

12: Tomb Mold Planetary Clairvoyance
Dieses Jahr war’s endlich soweit: Ich habe Death Metal verstanden. Lange Zeit habe ich mit dem Genre gefremdelt, es aber meist von außen interessant gefunden. Etwas verspätet hat mich nun auch endlich das Old-School-Death-Metal-Revival der letzten Jahre erreicht. Dabei war es besonders schön, neue Bands wie Tomb Mold zu entdecken, die für Nachgeborene den Sound alter Größen wie Death und Morbid Angel in spannende Richtungen steuern. „Planetary Clairvoyance“ ist ein monolithisches Album voller kompromissloser Songs, an dessen verwaschener Lo-Fi-Retro-Underground-Produktion ich mich dieses Jahr kaum satt hören konnte.
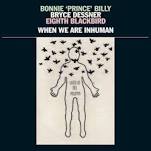
11: Bonnie „Prince“ Billy, Bryce Dessner, Eighth Blackbird When we are inhuman
Ein noch viel größeres Rätsel als „I made a Place“ bereitet Will Oldham zusammen mit Bryce Dessner von The National und dem Neoklassik-Ensemble Eighth Blackbird. When we are inhuman ist eine disparate Sammlung aus Folktraditionals, Mörderballaden und Avantgarde, die sich ihrer Widersprüchlichkeit vollends bewusst ist. Und sie findet in den verschiedenen Stimmungen, Klangästhetiken und Themenkomplexen letztlich den Triumph: ein widerspenstiges, überraschendes, herausforderndes und – vor allem – irrsinnig schönes Album.
Unsere Lieblingsalben im Jahresrückblick: Die Top 10

10: black midi Schlagenheim
Lange Zeit war ich zu faul, um mir das Debütalbum von black midi anzuhören. Wie konnte ich auch? Ein Gitarrenbanddebüt aus England, das von der gängigen Musikpresse abgefeiert wird. Das konnte ja nur langweilig sein. Ja, selbst Schuld: Als ich „Schlagenheim“ dann endlich im letzten Drittel des Jahres gehört habe, konnte ich sofort verstehen, was sich hinter Phrasen wie „energiegeladen“, „innovativ“ und „richtungsweisend“ verbirgt, weswegen ich jetzt versuche, genau diese Phrasen zu entlasten, damit alle, die diesen Text lesen und zweifeln, unbedingt doch dieses Album vor Jahresende noch hören.

9: Sunn O))) Pyroclasts
Aufmerksame Leser*innen werden sich erinnern, dass ich weiter oben in diesem Jahresrückblick kurz davor war, „Life Metal“ zum bis dato besten Sunn O)))-Album zu küren – doch dann kam „Pyroclasts“. Das Schwesteralbum ist aus Improvisationen entstanden, die die Aufnahmesessions zu „Life Metal“ begleitet haben, und es fungiert als eine Art Negativ zum eigentlichen Hauptwerk. Doch es so zu beschreiben tut der Tiefe dieses Albums Unrecht: „Pyroclasts“ ist kein Beiwerk zu „Life Metal“, sondern eine essenzielle Erweiterung. Stephen O’Malley empfiehlt, die beiden Alben verschränkt zu hören, und er hat Recht. Ohne „Pyroclasts“ klingt „Life Metal“ nun beinahe oberflächlich, und dass die grenzenlose Schönheit dieses Albums es vermag, das erste wie eine Skizze klingen zu lassen, ist vor allem ein Beweis dafür, wie gut Sunn O))) gerade sind.

8: Moor Mother Analog Fluids of Sonic Black Holes
Als Fan von experimenteller Musik bin ich es gewöhnt, Kritik von anderen musikbegeisterten Menschen zu hören. Vor allem monieren viele dabei, dass die Musik zu zerebral und steril sei. Allen, die dieses Jahr zu wenig zernoiste Experimente gehört haben, möchte ich das vierte Album von Camae Ayewa alias Moor Mother ans Herz legen. Selten war experimentelle Musik für mich so unmittelbar. Ayewa deutet klassische Spoken-Word-Protestgesänge und Elemente aus HipHop und Jazz zu klaustrophober, politischer Avantgarde um, und es ist unmöglich, die hier abgebildeten Gefühle von Wut, Angst und Ohnmacht nicht mit der vollen Intensität zu spüren.

7: Have A Nice Life Sea of Worry
Mit 27 viel zu spät durfte ich dieses Jahr doch noch das Erlebnis nachholen, dass eine Lieblingsband aus Jugendtagen mit mir zusammen erwachsen wird. Dan Barrett und Tim Macuga haben sich verdammt lange Zeit gelassen: Ihr Kultdebütalbum „Deathconciousness“ war 2009 sehr wichtig für mich, doch „The Unnatural World“ war, wenngleich auch toll, 2014 nicht die persönliche Weiterentwicklung, die ich gebraucht hätte, um mich im Endlich-erwachsen-Werden begleitet zu fühlen. „Sea of Worry“ ist nun genau das, und vielleicht rocken Dan und Tim jetzt auch mehr, weil sie endlich mittelalte Dads geworden sind. Diese Brüche – sowohl die alltäglicheren Sorgen um Vaterschaft und das Älterwerden als auch den geradlinigen Rock – in ihrem von religiösem Pathos aufgeladenen Gefühlskosmos macht Have A Nice Life für mich interessanter denn je. Gerade jetzt, wo ich genötigt bin, einen Jahresrückblick zu verfassen.

6: King Gizzard & the Lizard Wizard Infest the Rats’ Nest
Die längste Zeit über habe ich King Gizzard & the Lizard Wizard wegen ihres beknackten Namens gemieden, denn ich wähnte darunter so etwas wie Spaßpunk für Psychrock-Fans. Als ich das erste Mal mit der Single „Self-Immolate“ konfrontiert wurde, waren meine Zweifel wie weggeblasen: „Infest the Rats’ Nest“ befriedigt mein lange Zeit viel zu kurz gekommenes Bedürfnis nach unkompliziertem, eingängigem und kraftvollem Thrash Metal sogar besser, als es die Genre-Urväter von Metallica und Slayer zu tun vermögen. Und das liegt nicht zuletzt an dem Humor und dem grenzenlosen Enthusiasmus, mit dem die australischen Psychrocker ihrem ersten Thrash-Metal-Exkurs begegnen.

5: Tyler, the Creator IGOR
Ich habe Tyler, the Creator das letzte mal kurz nach „Wolf“ gehört, und damals hat mich seine Musik vor allem inhaltlich sehr schnell erschöpft. Umso schöner war es nun, „IGOR“ zu hören: Das Album, auf dem Tyler inhaltlich an die Reife seines musikalischen Talents anschließen kann – dachte ich mir zumindest. Denn wie ich nun herausfinden musste, hat Tyler den großen Schritt schon mit „Flower Boy“ gemacht, das ich nun wohl rückwirkend in meinem damals noch privaten Jahresrückblick für 2017 unterbringen muss. Trotzdem: „IGOR“ ist ein wunderbar empathisches Album, ebenso catchy wie anspruchsvoll, und es gelingt ihm, die gesamte Bandbreite romantischer Erfahrung abzubilden.

4: Sturgill Simpson Sound & Fury
Rein numerisch müsste Sturgill Simpsons viertes Album mein Album des Jahres sein. Kein Album habe ich dieses Jahr so viel gehört wie diese schwitzende Mischung aus 80er-Jahre Synthrock, Funk, Country, Disco und psychedelischem Noiserock. Sturgill Simpson gibt sich kraftmeierisch, doch hat diese potenziell katastrophale Mischung zu keinem Zeitpunkt den Mief von Muckertum und Machogehabe. Stattdessen ist „Sound & Fury“ eine gewohnt persönliche, wutentbrannte bis bittere Abrechnung mit der Musikindustrie und Simpsons wachsender Berühmtheit – und ein musikalischer sowie inhaltlicher Befreiungsschlag.

3: Blood Incantation Hidden History of the Human Race
Dieses Album hat mir im Alleingang den Death Metal erklärt, und damit eine Kaskade an Neukäufen und Genrerecherchen nach sich gezogen (siehe oben). Bislang habe ich die ausgemergelte Klangästhetik vom Black Metal dem Bassbrummen des Death Metal vorgezogen, doch Hidden History of the Human Race hat mir gezeigt, was sich alles unter technischer Versponnenheit und trüber Dichte verstecken kann: nämlich Schönheit und Wärme; entrückte, kosmisch-überspannte und wundervoll ambitionierte Kompositionen. Ihre Texte stecken, genau wie ihre Musik, voller psychedelischer, quasi-esoterischer Fantasie. Blood Incantations offenkundige Leidenschaft ist ansteckend, und ich habe ihnen eine ganze neue Musikwelt zu verdanken.

2: FKA twigs Magdalene
Was kann ein Album mehr leisten, als denen, die es hören, ein neues Genre zu eröffnen? FKA twigs’ „Magdalene“ erschafft sein eigenes Genre: ein filigranes Kunstwerk zwischen Artpop und R’n’B, das mir vom ersten Hören an die Sprache verschlagen hat. Ich habe lange gebraucht, um mich „Magdalene“ anzunähern, doch die dichte, schillernde Welt, die FKA twigs aufmacht, fordert diese Aufmerksamkeit immer wieder für sich ein – und der Gefühlskosmos von Songs wie „sad day“ und „daybed“, „mary magdalene“ und „thousand eyes“ hat mich über die Monate hinweg so sehr in seinen Bann gezogen wie nur ein anderes Album dieses Jahr.

1: Lingua Ignota Caligula
Lingua Ignotas „Caligula“ ist nicht das Album, das ich dieses Jahr am liebsten gehört habe, aber es ist das Album, das es am meisten verdient hat, gehört zu werden. Natürlich gefällt mir Kristin Hayters stilistische Kreuzung aus klassischer Musik, extremem Metal, Noise und Avantgarde extrem gut, doch vor allem hat kein zweites Album mich so eindringlich und anhaltend berührt wie dieses.
Hayter prangert Sexismus, Gewalt und Machtmissbrauch an – und teilt dabei schonungslos ihre eigenen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Dabei richtet sie die kulturell von Männern besetzten Domänen von klassischer Musik bis zu rauer, unmittelbarer Noiseavantgarde gegen die Hegemonie, die die angeprangerten Machtstrukturen am Leben erhält, nicht zuletzt auch in genau den Musikszenen, die ihr einst als Schutzraum gegolten haben.
Inhaltlich und formell ist „Caligula“ eine verheerendes, dringliches, politisch wie künstlerisch notwendiges Statement – und eines, das selbst mit wiederholtem Hören nichts von seiner Wirkkraft einbüßt.
