Leonard Cohen: Thanks for the Dance
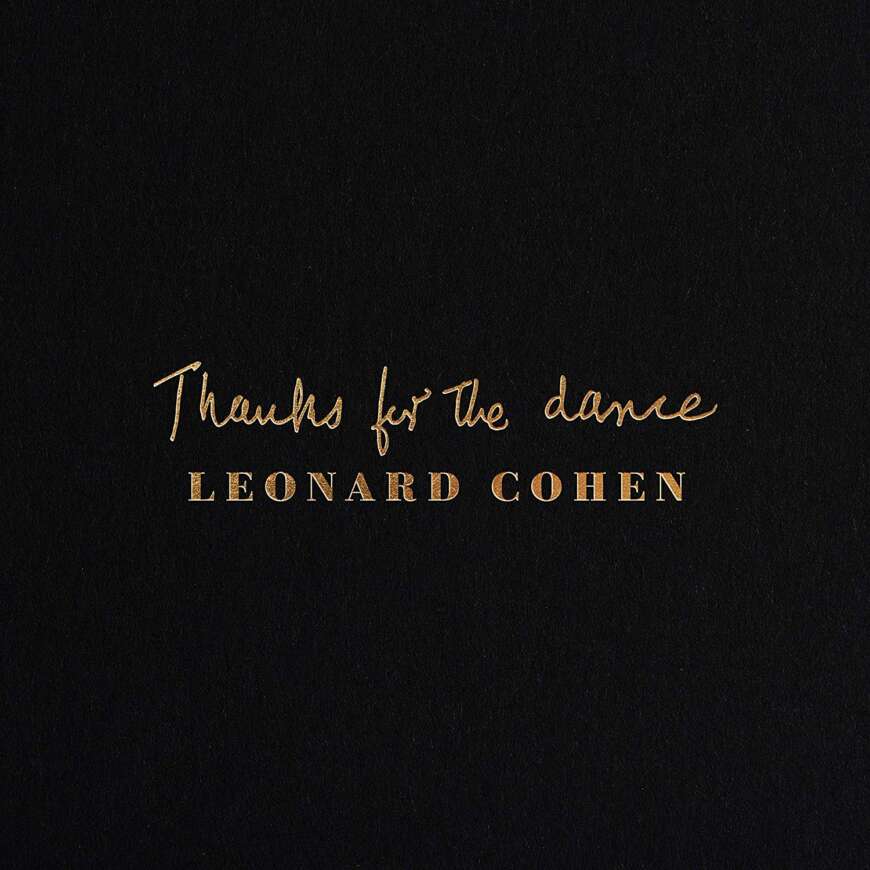
Abseits der Trauerarbeit gibt es tatsächlich gute Gründe, „Thanks for the Dance“, das posthume Album von Leonard Cohen zu hören.
Auch wenn kanonisierte Songwriter der 60er-Jahre in meiner musikalischen Welt kaum eine Rolle spielen: Leonard Cohen bildet eine Ausnahme. Es ist die ihm ureigene Melancholie, die mich für sein Frühwerk einnimmt, und es sind seine anhaltende Neugier und die Beschäftigung mit zeitgenössischen Ästhetiken, die auch Teile seines mittleren und späteren Werkes wie „I’m your Man“ (1988) oder „You want it darker“ (2016) interessant machen.
Leonard Cohens letztes Werk ist in guten Händen
Bei einer posthumen Veröffentlichung wäre normalerweise Vorsicht geboten, doch wenn jetzt drei Jahre nach Cohens Tod „Thanks for the Dance“ erscheint, liegen die Dinge etwas anders: Zwar konnte der Musiker sein fünfzehntes Studioalbum zu Lebzeiten nicht fertigstellen, doch die Vollendung und Veröffentlichung durch seinen Sohn Adam war von Cohen ausdrücklich gewünscht. Und obwohl das von Todesahnungen durchzogene „You want it darker“ ein – auch wenn das in diesem Kontext makaber klingen mag – perfekter Schlusspunkt gewesen wäre, ist „Thanks for the Dance“ weit mehr als eine bloße Appendix.
„Thanks for the Dance“ ist mehr als eine bloße Appendix
Als Ausgangsmaterial stand oft nicht viel mehr als Gesangsspuren zur Verfügung, dank der Mitwirkung von Musiker*innen wie Feist, Beck oder Bryce Dessner hat die Platte aber nichts Skizzenhaftes an sich: Flamenco-Gitarren, leise Choräle, Pianotupfer oder dezente Handclaps zentrieren sich um Cohens tiefe, weit nach vorn gemischte Stimme, die nun noch mehr als zuvor schon klingt, als würde sie aus anderen Sphären zu uns raunen. „I was always working steady / but I never called it art / I got my shit together / Meeting Christ and reading Marx“, resümiert er im Opener „Happens to the Heart“, in dem es um seine Beschäftigung mit Spiritualität ebenso geht wie um das Hadern mit der Liebe und den Gesetzmäßigkeiten des Lebens – wie so oft klingt Cohen dabei beschwörend und lakonisch zugleich.
Und es gibt noch weitere Songs, die zu den besten gehören, die sich in Cohens spätem Œuvre finden lassen; das zärtlich-düstere „It’s torn“, das von kraftvollen Morricone-Chören unterstützte „The Hills“ und der Closer „Listen to the Hummingbird“, der das Album mit der wahrscheinlich letzten Empfehlung beschließt, die Leonard Cohen seinen Hörer*innen auf den Weg gibt: „Listen to the Hummingbird / don’t listen to me.“ msb
