Alle Metallica-Alben im Ranking

Metallica werfen mit „S&M 2“ abermals den Blick zurück in den eigenen Songkatalog. Grund genug für einen kritischen Blick auf das Output der Metal-Legenden.
Vergangenen Freitag, am 28. 8., haben Metallica mit „S&M 2“ bereits ihr zweites Klassik-Crossover-Livealbum veröffentlicht – jenseits einer Werkschau ist der Anlass wie bereits beim ersten Mal fragwürdig. Trotzdem wollen wir die Veröffentlichung von „S&M 2“ zum Anlass nehmen, um uns dem Gesamtwerk der Metal-Legenden zu widmen: alle zehn Alben, vom schlechtesten bis zum besten gerankt.
Platz 10: St. Anger
 Niemanden wird’s wundern: Metallicas verhasstestes Album, „St. Anger“ von 2003, belegt mit schöner Regelmäßigkeit den letzten Platz in so ziemlich allen Rankings ihrer Alben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es schlichtweg die schlechtesten Seiten ihres Songwritings nach außen kehrt. Kaum ein Stück geht über die rudimentäre Idee einiger Riffs hinaus, und selbst in Sachen Riffing zieht „St. Anger“ gegenüber jedem anderen Metallica-Album den Kürzeren.
Niemanden wird’s wundern: Metallicas verhasstestes Album, „St. Anger“ von 2003, belegt mit schöner Regelmäßigkeit den letzten Platz in so ziemlich allen Rankings ihrer Alben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es schlichtweg die schlechtesten Seiten ihres Songwritings nach außen kehrt. Kaum ein Stück geht über die rudimentäre Idee einiger Riffs hinaus, und selbst in Sachen Riffing zieht „St. Anger“ gegenüber jedem anderen Metallica-Album den Kürzeren.
Mit „Frantic“ und dem Titelstück gibt es gerade einmal zwei Songs, die in irgendeiner Weise hängen bleiben. Dennoch sei hier zumindest eins lobend erwähnt: Der radikal hingerotzte Sound ist nicht so durchweg schlecht, wie er gerne vorgeführt wird. Bloß schaffen es vergessenswerte Tiefpunkte wie „My World“, „Invisible Kid“ oder „Sweet Amber“ einfach nicht, dieser Rohheit erinnerungswürdige Momente abzutrotzen.
Platz 9: Reload
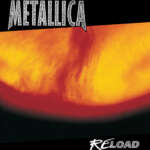 Wir bleiben beim Thema der verhassten Alben: Von den beiden Hardrock-Exkursen, die Metallica nach dem Erfolg des selbstbetitelten, radiotauglichen „Schwarzen Albums“ versucht haben, muss „Reload“ notwendigerweise den Kürzeren ziehen. Der zurückgelehnt groovende Grunge-Hardrock war in der zweiten Hälfte des Jahres 1996 bereits verbraucht.
Wir bleiben beim Thema der verhassten Alben: Von den beiden Hardrock-Exkursen, die Metallica nach dem Erfolg des selbstbetitelten, radiotauglichen „Schwarzen Albums“ versucht haben, muss „Reload“ notwendigerweise den Kürzeren ziehen. Der zurückgelehnt groovende Grunge-Hardrock war in der zweiten Hälfte des Jahres 1996 bereits verbraucht.
Wieder sind es zwei Hits, „Fuel“ und „The Memory remains“, die das Album vor der absoluten Überflüssigkeit retten. Doch ist es umso schwerer, den Rest des Albums durchzustehen, wenn diese beiden Songs bereits am Anfang jegliches Pulver verschießen, das Metallica noch zur Verfügung hatten. Übrig bleiben nur noch peinliche Entgleisungen wie „Carpe Diem Baby“.
Platz 8: Death magnetic
 Mit Platz 8 nähern wir uns den Rängen, auf denen man sich nicht mehr für die vorliegenden Alben schämen muss: „Death magnetic“ war 2008 eine willkommene Rückkehr zum klassischen Thrash Metal und notgedrungenerweise eine Beschwichtigungs-Taktik. „Schaut!“, riefen James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und der frisch dazugestoßene Rob Trujillo, „Wir habens noch drauf!“ Zur Hälfte lässt sich dem zustimmen.
Mit Platz 8 nähern wir uns den Rängen, auf denen man sich nicht mehr für die vorliegenden Alben schämen muss: „Death magnetic“ war 2008 eine willkommene Rückkehr zum klassischen Thrash Metal und notgedrungenerweise eine Beschwichtigungs-Taktik. „Schaut!“, riefen James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und der frisch dazugestoßene Rob Trujillo, „Wir habens noch drauf!“ Zur Hälfte lässt sich dem zustimmen.
„Death magnetic“ läuft so rund und routiniert, wie eine Band es gebraucht hat, die fünf Jahre zuvor beinahe jegliches Wohlwollen ihrer Fans verspielt hatte. Nimmt man das Album für sich, ist mit „Broken, beat and scarred“, „The End of the Line“, „All Nightmare long“ und „That was just your Life“ vor allem die erste Hälfte grandios. Auf die Länge gerechnet geht dem 74-minütigen Album jedoch bald die Puste aus, woran allerdings auch die legendär furchtbare Alles-auf-Maximum-Produktion schuld ist.
Platz 7: Hardwired… to self-destruct
 Trotzdem: Man muss „Death magnetic“ zugute halten, dass Metallica ohne es wohl nie „Hardwired… to self-destruct“ gemacht hätten. Es wirkt ein bisschen, als hätten sie sich die schlechten Gewohnheiten der „St. Anger“-Ära erstmal aus dem Leib spielen müssen. Mit „Hardwired…“ sind Metallica 2016 vom Major-Label zu ihrem eigenen gewechselt und haben sich auch sonst die kreative Kontrolle zurückgeholt.
Trotzdem: Man muss „Death magnetic“ zugute halten, dass Metallica ohne es wohl nie „Hardwired… to self-destruct“ gemacht hätten. Es wirkt ein bisschen, als hätten sie sich die schlechten Gewohnheiten der „St. Anger“-Ära erstmal aus dem Leib spielen müssen. Mit „Hardwired…“ sind Metallica 2016 vom Major-Label zu ihrem eigenen gewechselt und haben sich auch sonst die kreative Kontrolle zurückgeholt.
So jung und voller Spaß wie auf dem eröffnenden Dreier-Gespann aus „Hardwired“, „Atlas, rise!“ und „Now that we’re dead“ haben Metallica seit den 90ern nicht mehr geklungen. Wo „Hardwired…“ jedoch immer noch schwächelt: in der Länge. Wieder gehen der Band auf den mehr als 70 Minuten des Albums die Ideen aus.
Platz 6: Load
 „Load“ ist voller Ideen – aller Kritik zum Trotz, die es seinerzeit geerntet hat. Zwar mag der Ansatz, weiterhin abseits des Metals zu weilen, nach dem oben bereits erwähnten Erfolg des selbstbetitelten schwarzen Albums kein origineller gewesen sein. Doch wirkten Metallica in diesem Sound eine Zeit lang wirklich souverän, etwa wenn sie „Mama said“ mit einer gehörigen Portion Country-Twang anreichern.
„Load“ ist voller Ideen – aller Kritik zum Trotz, die es seinerzeit geerntet hat. Zwar mag der Ansatz, weiterhin abseits des Metals zu weilen, nach dem oben bereits erwähnten Erfolg des selbstbetitelten schwarzen Albums kein origineller gewesen sein. Doch wirkten Metallica in diesem Sound eine Zeit lang wirklich souverän, etwa wenn sie „Mama said“ mit einer gehörigen Portion Country-Twang anreichern.
Zum grundsoliden Alternative-Metal-Sound kommen dann noch Ausreißer-Tracks wie „Until it sleeps“ und „King Nothing“. Das zeigt im Rückblick vor allem, für wie selbstverständlich man Metallica noch bis spät in die 90er-Jahre gehalten hat, und wie sehr sie sich schon kurz darauf in ihrem eigenen Sound festgefahren haben. Denn egal, wie solide ihre heutigen Thrash-Metal-Platten auch sein mögen, werden sie doch wohl kaum so subtile wie schlüssige Experiment liefern, wie es „Load“ 1996 getan hat.
Platz 5: … and Justice for all
 Aus Metallicas Ära der Thrash-Alben ist „… and Justice for all“ leider das Schwächste. Dass es dennoch auf Platz fünf des Alben-Rankings landet, ist ein Zeichen dafür, wie kreativ und endlos fruchtbar ihr Songwriting einst gewesen ist. Noch ein weiteres Zeichen dafür ist es, dass Metallica auch nach dem tragischen Tod ihres Bassisten Cliff Burton 1986, also nur zwei Jahre vor „… Justice“, noch ein so in sich schlüssiges Album geliefert haben, das zudem noch ihren Sound nach vorne trägt.
Aus Metallicas Ära der Thrash-Alben ist „… and Justice for all“ leider das Schwächste. Dass es dennoch auf Platz fünf des Alben-Rankings landet, ist ein Zeichen dafür, wie kreativ und endlos fruchtbar ihr Songwriting einst gewesen ist. Noch ein weiteres Zeichen dafür ist es, dass Metallica auch nach dem tragischen Tod ihres Bassisten Cliff Burton 1986, also nur zwei Jahre vor „… Justice“, noch ein so in sich schlüssiges Album geliefert haben, das zudem noch ihren Sound nach vorne trägt.
„… and Justice for all“ ist verproggter, kopflastiger und cinematischer („One“!) als der Vorgänger „Master of Puppets“, was ihm eine einzigartige Stellung im Metallica-Kanon zukommen lässt. Einige Experimente gehen jedoch nach hinten los: Die Produktion stellt den Bass des Neuzugangs Jason Newsted nach hinten. Zusammen mit dem berüchtigten Snare-Sound von Lars Ulrich ergibt das einen Sound, dem gelegentlich das Fundament fehlt, um die überbordenden Songs der zweiten Hälfte wie „The frayed Ends of Sanity“ und „Dyers Eve“ zu tragen.
Platz 4: Metallica
 Geht man vom beinahe maßlosen „… and Justice for all“ aus, scheint der Schluss, auf Reduktion zu setzen, offensichtlich. Es ist jedoch leicht, aus den Augen zu verlieren, wie wahnwitzig es damals schien, dass das unfassbar erfolgreiche selbstbetitelte „Schwarze Album“ zu der kürzeren Songdauer und den zugänglicheren Songstrukturen noch einen ruhigeren Hardrock-Sound entwirft.
Geht man vom beinahe maßlosen „… and Justice for all“ aus, scheint der Schluss, auf Reduktion zu setzen, offensichtlich. Es ist jedoch leicht, aus den Augen zu verlieren, wie wahnwitzig es damals schien, dass das unfassbar erfolgreiche selbstbetitelte „Schwarze Album“ zu der kürzeren Songdauer und den zugänglicheren Songstrukturen noch einen ruhigeren Hardrock-Sound entwirft.
Nicht zuletzt haben Metallica damit 1991 den Weg für den Metal in den Mainstream geebnet, was vor allem am großartigen Songwriting liegt: „Enter Sandman“, „Sad but true“, „The Unforgiven“, „Nothing else matters“ – beinahe die gesamte Tracklist geht direkt ins Ohr. Im Nachhinein lässt sich leicht sagen, dass „Metallica“ für die Band der Anfang vom Ende gewesen ist, und, dass sie danach kaum je wieder so vital gewirkt haben, wie davor. Doch für einen kurzen Moment sah es so aus, als könnten James Hetfield und co. gar nicht scheitern.
Platz 3: Master of Puppets
 Der wirkliche Wendepunkt in ihrer Karriere war allerdings „Master of Puppets“ 1986: Hier haben Metallica alles perfektioniert, was sie heute ausmacht. Ihren Thrash-Sound haben sie von allen Referenzen an frühere Einflüsse aus der New Wave of British Heavy Metal befreit und damit ganz zu sich selbst gefunden. Das bedeutet auf der Pro-Seite mit „Battery“, „Master of Puppets“, „The Thing that should not be“ und „Welcome Home (Sanitarium)“ die mithin beste A-Seite in Metallicas Songkatalog überhaupt. Vier Songs, die zu Recht noch heute auf keinem Metallica-Konzert fehlen dürfen.
Der wirkliche Wendepunkt in ihrer Karriere war allerdings „Master of Puppets“ 1986: Hier haben Metallica alles perfektioniert, was sie heute ausmacht. Ihren Thrash-Sound haben sie von allen Referenzen an frühere Einflüsse aus der New Wave of British Heavy Metal befreit und damit ganz zu sich selbst gefunden. Das bedeutet auf der Pro-Seite mit „Battery“, „Master of Puppets“, „The Thing that should not be“ und „Welcome Home (Sanitarium)“ die mithin beste A-Seite in Metallicas Songkatalog überhaupt. Vier Songs, die zu Recht noch heute auf keinem Metallica-Konzert fehlen dürfen.
Die B-Seite liefert mit „Disposable Heroes“, „Leper Messiah“ und „Damage, Inc.“ die szeneverbundenen Geheimtipps. Auf „Master of Puppets“ halten sich rückblickend der Mainstream- und der Szene-Legendenstatus die Waage. Eine prekäre Balance, die schon bald darauf kippen sollte – und die dazu führt, dass das Album aus heutiger Sicht etwas ungerade wirkt: Die A-Seite totgehört, die B-Seite etwas trübe in der Erinnerung. Doch genügt ein Durchgang, um das Album wieder als den Meilenstein zu zementieren, den es auch heute noch in der Metal-Geschichte darstellt.
Platz 2: Kill ’em all
 Weniger originell ist indes Metallicas Debütalbum „Kill ’em all“ von 1983, was die Band allerdings mit einer bis heute noch kaum erreichten Energie wettgemacht hat. Nie wieder waren Metallica so ungeschliffen wie auf ihrem Debüt, nie so punkig, nie so spontan. Nicht nur hat „Kill ’em all“ dem Thrash Metal mit „Whiplash“ seinen Namen gegeben, es hat auch in Metallicas Albumkatalog das Alleinstellungsmerkmal der vollkommenen Befreitheit von jedwedem Pathos. Wo „Master of Puppets“ und „… and Justice for all“ sich zunehmend Ballast anreicherten, sind James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton und Kirk Hammett hier noch völlig losgelöst von Erwartungshaltungen und Ambitionen.
Weniger originell ist indes Metallicas Debütalbum „Kill ’em all“ von 1983, was die Band allerdings mit einer bis heute noch kaum erreichten Energie wettgemacht hat. Nie wieder waren Metallica so ungeschliffen wie auf ihrem Debüt, nie so punkig, nie so spontan. Nicht nur hat „Kill ’em all“ dem Thrash Metal mit „Whiplash“ seinen Namen gegeben, es hat auch in Metallicas Albumkatalog das Alleinstellungsmerkmal der vollkommenen Befreitheit von jedwedem Pathos. Wo „Master of Puppets“ und „… and Justice for all“ sich zunehmend Ballast anreicherten, sind James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton und Kirk Hammett hier noch völlig losgelöst von Erwartungshaltungen und Ambitionen.
Gerade deswegen gelingen die ambitionierteren Stücke wie das grandiose Epos „The Four Horsemen“ oder das von Cliff Burton komponierte Instrumental mit dem Bass in der Hauptrolle „(Anesthesia) – pulling Teeth“: Weil Metallica sich hier noch ausprobiert haben. Das mag dazu führen, dass der Rest eine reine, geradlinige Mischung aus Metal und Punk ist, bei der zu dieser Zeit noch die Übergänge sichtbar waren. Doch gerade mit dem Ballast der Bandgeschichte wirken „Hit the Lights“, „Whiplash“ und „Seek & destroy“ heute herrlich unverbraucht.
Platz 1: Ride the Lightning

Es ist also kein Wunder, dass gerade „Ride the Lightning“, das zweite Metallica-Album von 1984, aus heutiger Sicht so großartig klingt. Die ersten Ausläufer in Richtung ihres klassischen Sounds sind hier bereits vorhanden: „For whom the Bell tolls“ und „Fade to black“ sind bereits die Metallica-Songs der 90er, bevor der klassische Sound der Band ihr zum Verhängnis werden konnte.
„Creeping Death“, „Trapped under Ice“ und „Fight Fire with Fire“ haben dagegen noch die gesammelte Kraft der jugendlichen Punk-Energie aus den „Kill ’ em all“-Tagen, während „The Call of Ktulu“ und „Ride the Lightning“ bereits die großen Ambitionen realisieren, die Metallica später mit „Master of Puppets“ auf Albumlänge verfolgt haben. „Ride the Lightning“ ist alles, was an Metallica toll ist, in Reinform destilliert.
