„Für immer seh ich dich wieder“ von Yannic Han Biao Federer
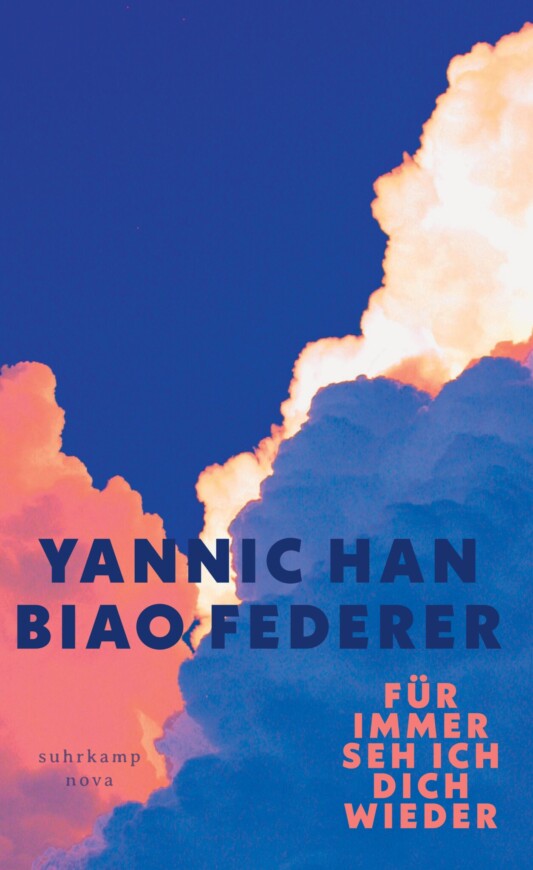
Etwa alle 20 Seiten unterbricht sich die Lektüre von „Für immer seh ich dich wieder“ quasi von selbst, so unvermittelt rührt Yannic Han Biao Federer – im besten Sinne – zu Tränen.
Yannic Han Biao Federer ist schon lange kein Unbekannter mehr in der deutschen Gegenwartsliteratur. Der gebürtige Südbadener ist Doktor der Literatur, Preisträger der Wuppertaler Literatur-Biennale und des Ingeborg-Bachmann-Preises, Essayist, Kolumnist, Autor von drei Romanen und einem Theaterstück – und Vater.
Nun, das eigentlich nicht mehr. Aber dazu gleich.
Ging es in Federers früheren Geschichten noch um jugendliches Draufgängertum, Ausbeutung fremder Biografien für das eigene Schreiben oder gar antichinesische Gewalt in Indonesien, kehrt er in seinem dritten Roman „Für immer seh ich dich wieder“ den Blick unentrinnbar nach innen.
Charlotte und Yannic (eine autofiktionale Version des Autors) erwarten ein Kind – und tun vorher, was getan werden muss. Vereinbaren Termine fürs Pränatalscreening, rechnen Elterngeldbezüge durch, richten das Kinderzimmer ein. Doch dann stirbt ihr Sohn im Mutterleib. Eben haben sie noch die besten Angebote für Stillkissen und Wickeltische gegoogelt, nun sind es Kindersärge, ein Kindergrab. Und immer wieder kracht die Erkenntnis rein: Das hier geschieht wirklich. Das ist kein krudes Plot-Device, kein notwendiges Übel, keine Telenovela. Die erschütterte Verwandtschaft lässt nicht lange auf sich warten, Freunde reisen an oder nehmen Anteil aus der Ferne, tragen Opferschalen in den Tempel. Und während das junge Paar mit einer Bürokratie kämpft, für die totgeborene Kinder eine unbekannte Größe darstellen, beginnt Yannic eine Chronik dieses neuen, verdüsterten Alltags.
Alle 20 Seiten weinen
Knapp 200 Seiten ist die Nabelschau lang, und jede einzelne fühlt sich an wie ein Hammerschlag. Sei es wegen dem, was geschildert wird, oder dem, was eben nicht geschildert wird und zwischen den Zeilen steckt: Die Schalheit des Beileids, die umgebende Welt, die sich weiterdreht, egal wie viele Menschen sich dagegenstemmen. Erschütternd minutiös, dabei aber nie kalt, schildert Federer den Strom von Erledigungen, Anträgen, Umgängen, die der Tod eines Menschen nach sich zieht, der noch gar keine Spuren hinterlassen konnte. Qua Verzicht auf Anführungszeichen und Akzentuierung durch Absätze entwickelt der Text einen Sog, in dem alle Informationen gleichwertig und gleich weit entfernt durcheinander rauschen.
Und das erwischt rückstandslos alle: Werdende Eltern, bereits gewordene und sicherlich selbst Menschen, die sich gegen Kinder entschieden haben. Etwa alle 20 Seiten unterbricht sich die Lektüre quasi von selbst, so unvermittelt rührt sie – im besten Sinne – zu Tränen; entsprechend dauert das Buch seine Zeit. Und wird gerade da groß, wo Federer seine eigene Rolle als Chronist des Unglücks hinterfragt, zwischen Schreiben als Verarbeitungsmechanismus und der antizipierten Vermarktbarkeit von Leid.
