„Im Land der Vergessenen“ von Aliyeh Ataei
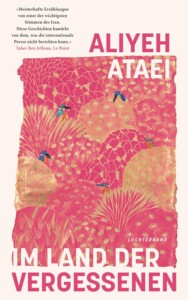
Die im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Iran aufgewachsene Autorin Aliyeh Ataei zeichnet mit den autobiografischen Erzählungen aus „Im Land der Vergessenen“ unvergessliche Bilder.
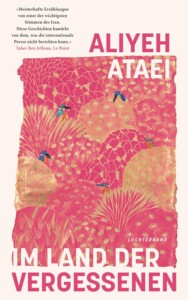
Die im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Iran aufgewachsene Autorin Aliyeh Ataei zeichnet mit den autobiografischen Erzählungen aus „Im Land der Vergessenen“ unvergessliche Bilder.

„Der falsche Erbe“ von Josephine Tey bleibt spannend – auch, wenn man sich nicht für Pferde-Content interessiert.

Bei Jake Hinkson muss „Die Tochter des Predigers“ erkennen: Auch in Arkansas sterben Menschen nicht nur durch wütende Hirsche und Gottes Hand.
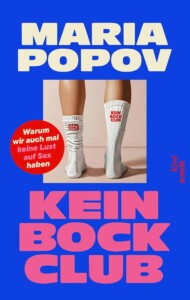
Mit dem YouTube-Kanal „Auf Klo“ hat sie bis 2023 über Sex aufgeklärt, nun gibt die Journalistin Maria Popov in dem autobiografischen Sachbuch „Kein Bock Club“ zu, dass sie asexuell ist.

Mit den Erzählungen von „Dein Utopia“ geht es Bora Chung trotz schwarzem Humors um todernste Themen wie häusliche Gewalt und Transphobie.

Mit „Schwanentage“ wirft Zhang Yueran einen sanften, aber ungeschönten Blick ins moderne China.

„Karizma“ von Sara Gmuer ist eine stolze Straßen-Lovestory, die sonst so oft nur aus der männlichen Perspektive erzählt wird.

Der Debütroman „Inventur der Erinnerungen“ von Ekaterina Feuereisen macht keinen Spaß und ist anstrengend – aber genau das ist gewollt.