Die besten Alben der Woche

Nach 27 Jahren legen die Jeremy Days wieder ein Album vor, Destroyer wagt sich in die 80er, und Selah Sue erweist sich als Alleskönnerin.
Diese Woche finden sowohl Nostalgiker:innen als auch Aufbruchsfreudige das perfekte Album für den eigenen Geschmack. Für mehrere Platten, die am Freitag erscheinen, haben Fans eine Menge Geduld gebraucht. So haben sich Seabear ganze zwölf Jahre Zeit gelassen für „In another Life“, und bei den Jeremy Days liegt die letzte Platte gar 27 Jahre zurück! Zum Glück knüpfen alle Beteiligten mühelos an alte Stärken an, was auch für Bodi Bill gilt. In ganz neue Gefilde wagen sich dagegen Selah Sue, die sich auf „Persona“ als ungeahnt facettenreich erweist, sowie Titelheld Destroyer mit „Labyrinthitis“.
Seabear : In another Life
 Wüstensound zwischen Geysiren – kann das funktionieren? Seabear wagen es und mixen ihren skandinavischen Pop mit Westerngitarre und Americana-Atmosphäre. Doch „In another Life“ bietet noch viel mehr: Songwriterfolk trifft auf turbulenten Pop, eben noch Those Dancing Days mit Bläsern und Geigensturm, im nächsten Augenblick Mazzy Star mit wispernder Instrumentierung. Dass diese Kombination gelingt, liegt vor allem daran, dass das sechsköpfige Kollektiv kein Newcomer ist – zwölf Jahre haben sich Seabear für diese neue Platte gegönnt. In der Zwischenzeit haben so illustre Mitglieder wie Sóley oder Sin Fang ihre Solokarrieren vorangetrieben und bringen nun diese Erfahrungen mit in das Projekt.
Wüstensound zwischen Geysiren – kann das funktionieren? Seabear wagen es und mixen ihren skandinavischen Pop mit Westerngitarre und Americana-Atmosphäre. Doch „In another Life“ bietet noch viel mehr: Songwriterfolk trifft auf turbulenten Pop, eben noch Those Dancing Days mit Bläsern und Geigensturm, im nächsten Augenblick Mazzy Star mit wispernder Instrumentierung. Dass diese Kombination gelingt, liegt vor allem daran, dass das sechsköpfige Kollektiv kein Newcomer ist – zwölf Jahre haben sich Seabear für diese neue Platte gegönnt. In der Zwischenzeit haben so illustre Mitglieder wie Sóley oder Sin Fang ihre Solokarrieren vorangetrieben und bringen nun diese Erfahrungen mit in das Projekt.
Das ist ein großer Gewinn und macht aus den elf Songs ein Pop-Potpourri, das glaubwürdig sämtliche Facetten des skandinavischen Folkpop auslotet, dabei aber trotz mehrstimmiger Effekte, purzelnder Synthie- und Drum-Arrangements nie überladen wirkt. Im Gegenteil: Bei aller Zugänglichkeit behält sich „In another Life“ verborgene Ecken und Nischen vor, die nach und nach entdeckt werden wollen.
„In another Life“ gibt es bei Amazon und bücher.de zu kaufen.
Selah Sue: Persona
 Wer die Belgierin eher als poppige Reggae-Künstlerin abgespeichert hat, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Mit „Persona“ erweist sich Selah Sue als waschechte Alleskönnerin und wirft Bläser, Break-Beats, warme Bäss, ein Timmy-Thomas-Sample, Soul-Chöre und en bisschen Rap zusammen. Auch für Disco und HipHop ist Platz. Und wenn das Album in der zweiten Hälfte manchmal etwas zu nett klingt, machen das Highlights wie „All the Way down“ spielend wieder wett.
Wer die Belgierin eher als poppige Reggae-Künstlerin abgespeichert hat, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Mit „Persona“ erweist sich Selah Sue als waschechte Alleskönnerin und wirft Bläser, Break-Beats, warme Bäss, ein Timmy-Thomas-Sample, Soul-Chöre und en bisschen Rap zusammen. Auch für Disco und HipHop ist Platz. Und wenn das Album in der zweiten Hälfte manchmal etwas zu nett klingt, machen das Highlights wie „All the Way down“ spielend wieder wett.
„Persona“ gibt es bei Amazon und bücher.de zu kaufen.
Christian Lee Hutson: Quitters
 Zwei Jahre ist es nun her, dass Phoebe Bridgers ihr großartiges Album „Punisher“ veröffentlicht hat, auf dem sie in dem Song „Chinese Satellite“ folgende Zeilen singt: „Drowning out the morning birds/With the same three songs over and over/I wish I wrote it, but I didn’t so I learn the words/Hum along ’til the feeling’s gone forever.“ Jene drei Songs stammen nicht etwa von Elliott Smith oder Chan Marshall, sondern von Bridgers’ bestem Freund Christian Lee Hutson, dessen Debütalbum „Beginners“ sie produziert hat.
Zwei Jahre ist es nun her, dass Phoebe Bridgers ihr großartiges Album „Punisher“ veröffentlicht hat, auf dem sie in dem Song „Chinese Satellite“ folgende Zeilen singt: „Drowning out the morning birds/With the same three songs over and over/I wish I wrote it, but I didn’t so I learn the words/Hum along ’til the feeling’s gone forever.“ Jene drei Songs stammen nicht etwa von Elliott Smith oder Chan Marshall, sondern von Bridgers’ bestem Freund Christian Lee Hutson, dessen Debütalbum „Beginners“ sie produziert hat.
Für Hutsons zweites Album teilt sie sich nun den Regiestuhl mit Conor Oberst, und „Quitters“ setzt ein Rufzeichen hinter die Erkenntnis, dass der 31-jährige Songwriter aus L.A. nicht nur zu dem Kreis jener jungen Musiker:innen zählt, die das Folkgenre wieder aufregend machen, sondern sogar die Fingerpicking-Technik rehabilitieren kann. „Rubberneckers“ hätte auch auf „Punisher“ zu den Highlights gezählt, bei der Ballade „Age Difference“ sind Tränen unvermeidlich … Ach, Bridgers kann auf ihrem nächsten Album von 13 Songs singen, die sie gern geschrieben hätte.
„Quitters“ gibt es bei Amazon und bücher.de zu kaufen.
The Jeremy Days: Beauty in Broken
 Dummerweise erinnern sich die meisten Leute an die Jeremy Days nur als die „Band mit dem Hit“. Mit „Brand new Toy“ haben es die fünf Hamburger 1989 nicht nur in die Charts geschafft, sondern sogar in die legendäre ZettDehEff-Hitparade, und von diesem Auftritt erzählt Sänger Dirk Darmstädter noch heute gerne großartigen Anekdoten. Doch die Band, die nach dem Debüt mit „Circushead“ noch ein zweites, sehr reifes Album nachgelegt hat, konnte nie wirklich die erste Pop-Liga erobern. Nach fünf Alben war Schluß, und die einstige Musiker-WG ist in Streit und Zank auseinander gegangen.
Dummerweise erinnern sich die meisten Leute an die Jeremy Days nur als die „Band mit dem Hit“. Mit „Brand new Toy“ haben es die fünf Hamburger 1989 nicht nur in die Charts geschafft, sondern sogar in die legendäre ZettDehEff-Hitparade, und von diesem Auftritt erzählt Sänger Dirk Darmstädter noch heute gerne großartigen Anekdoten. Doch die Band, die nach dem Debüt mit „Circushead“ noch ein zweites, sehr reifes Album nachgelegt hat, konnte nie wirklich die erste Pop-Liga erobern. Nach fünf Alben war Schluß, und die einstige Musiker-WG ist in Streit und Zank auseinander gegangen.
Doch dann waren die Jeremy Days 2019 plötzlich wieder da. Nach einem ausverkauften Comeback-Konzert und einer Tour erscheint nun das erste Album nach 27 Jahren.
„Beauty in broken“ klingt sehr anders als „Punk by Numbers“, mit dem sich die Band 1995 verabschiedet hatte. Der Sound ist wieder frisch und druckvoll wie zu Beginn der Reise. Darmstädter, der als einziger nach dem Split eine Solo-Karriere gestartet hat, hält mit seiner Stimme und seinem soften US-Akzent alles zusammen. „For the Lovers“, „Blue new Year“ und das hinreißende „Stupid November“ sind ganz großer Pop. Und mit der ersten Single, dem hitverdächtigen Titelsong, könnten es die Jungs jederzeit wieder in die Hitparaden schaffen.
„Beauty in broken“ gibt es bei Amazon und bücher.de zu kaufen.
Bodi Bill: I love u I do
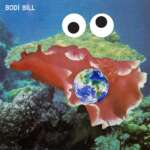 Nach langer Zeit findet das Berliner Trio wieder zusammen und präsentiert mit Tracks wie „Loophole Traveling“ oder „Good Advice“ ein liebevolles Sammelsurium aus Indie-Songskizzen und scheinbar wirren Gedanken. Dabei geht es weniger um den großen Wurf als um gute Laune, Entspanntheit und einen absurden Unterton. Mitgrund für die gemütliche Atmosphäre: Fabian Fenk ist kürzlich zum ersten Mal Vater geworden.
Nach langer Zeit findet das Berliner Trio wieder zusammen und präsentiert mit Tracks wie „Loophole Traveling“ oder „Good Advice“ ein liebevolles Sammelsurium aus Indie-Songskizzen und scheinbar wirren Gedanken. Dabei geht es weniger um den großen Wurf als um gute Laune, Entspanntheit und einen absurden Unterton. Mitgrund für die gemütliche Atmosphäre: Fabian Fenk ist kürzlich zum ersten Mal Vater geworden.
„I love u I do“ gibt es bei Amazon und bücher.de zu kaufen.
Destroyer: Labyrinthitis
 Der Sommer 2015 hat alles verändert: Kaum war das Destroyer-Album „Poison Season“ erschienen, konnte man für lange Zeit nirgendwo mehr einen überteuerten Kaffee trinken, ohne dass im Hintergrund dieses so eigenwillige wie wunderbare Jazzpop-Wunderwerk lief.
Der Sommer 2015 hat alles verändert: Kaum war das Destroyer-Album „Poison Season“ erschienen, konnte man für lange Zeit nirgendwo mehr einen überteuerten Kaffee trinken, ohne dass im Hintergrund dieses so eigenwillige wie wunderbare Jazzpop-Wunderwerk lief.
Auch Dan Bejar selbst scheint das ermüdet zu haben, denn seit drei Alben ist der Kanadier auf stilistischer Flucht, und bei „Labyrinthitis“ streift er nun durch die Waveclubs der 80er. Klar, wenn der Opener „It’s in your Heart now“ an The Cure erinnert, kennen wir das schon von „Ken“. Auch New-Order-Referenzen tauchen im Destroyer-Kosmos immer wieder auf – nur ist eben „All my pretty Dresses“ ein Hit, den die Briten seit „Crystal“ nicht mehr geschafft haben. Und komplett neu sind die EBM-Sprengsel, um die Bejar Songs wie „Suffer“ und „Eat the Wine, drink the Bread“ baut.
Rückgriffe sind bei Destroyer ja eh nie langweilig, werden sie doch stets in die angestammte Gemengelage zwischen Softrock und experimentellen Spinnereien eingefasst und mit kryptischen Texten garniert, in denen Bejar hier vor allem mit Mystik und spirituellen Traumsequenzen hantiert. Nur Kaffee mag zu dieser Platte nicht so richtig passen.
