„Das Bildnis des Oscar Wilde“ von Stephen Alexander
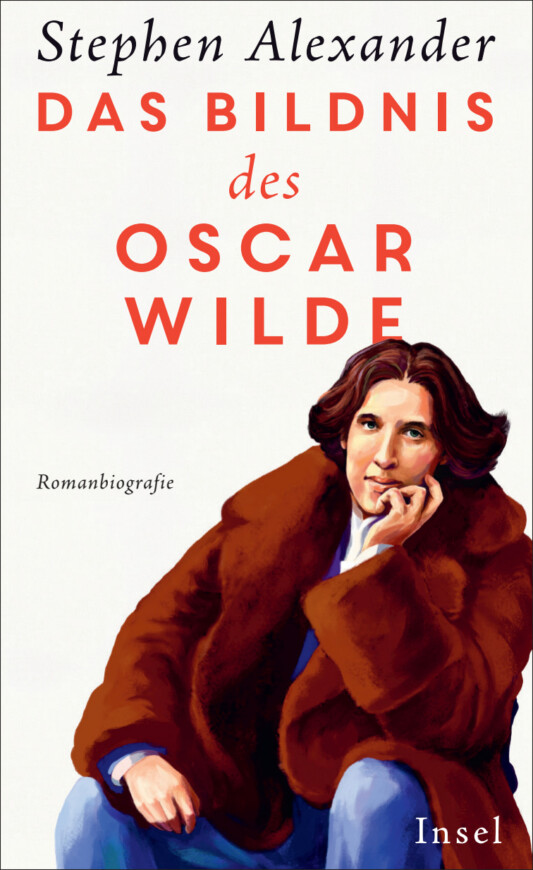
Toxic Relationship, Fin-de-Siècle-Style: „Das Bildnis des Oscar Wilde“ von Stephen Alexander erzählt vom letzten Unglück des irischen Dramatikers.
Bei den diesjährigen Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt diskutierte die Jury unter anderem die „moralische Verantwortung“, die gerade Texte hätten, die sich von tatsächlich ereigneter Geschichte abhängig machen würden. Historische Figuren als Protagonist:innen seien immer heikel, weil sie eine grundsätzliche Überprüfung der Erzählposition erforderten.
„Ich war nicht dabei, ich kann alle Briefe und Tagebücher lesen, aber ich bin nicht dabei gewesen“, sagte etwa Jurorin Brigitte Schwens-Harrat. Sobald es um reale Personen gehe, stelle sich die Frage, wie man signalisieren könne, dass dies reale Personen seien und es sich gleichzeitig um einen Roman handle. „Das ist eine Frage von Nähe und Distanz, die man abschätzen muss.“
Und auch Stephen Alexander, studierter Anglist und Theaterwissenschaftler, findet darauf keine rechte Antwort.
Auf den Schultern von Giganten ist es wacklig
Seine literarische Biografie von Oscar Wilde – dem Epitom von Dandy- und Dichtertum im ausgehenden 19. Jahrhundert – setzt etwa um 1891 ein. Wilde wird für seinen „Dorian Gray“ und seine aperçu-schwangeren Gesellschaften gefeiert, die wenig verhohlene Homosexualität wird ihm als exzentrischem Künstler einigermaßen nachgesehen, und auch seine Alibi-Ehe mit Constance ist glücklich. Doch als er auf einem Ball den jungen Lord Alfred Douglas trifft, Sohn des notorischen Schwulenhassers Marquess of Queensberry, verliebt sich der Dramatiker Hals über Kopf. Der Grundstein für eine gut drei Jahre währende, nach heutigem Maßstab höchst toxische On-off-Beziehung ist gelegt. Sie wird mit Wildes Verurteilung, Internierung und letztlichem Tod enden.
Bei diesem Sujet bestehen mehrere Herausforderungen: Erstens muss, wer sich einer so sprachpotenten Figur wie Oscar Wilde annimmt, in Sachen Prosa und Witz eine Eigenständigkeit beweisen, ohne dass der Eindruck entsteht, man wolle mit dem Vorbild gleichziehen. Hier fehlt Alexanders Ausdruck der Fluss. Das Ergebnis: eine allzu spröde Einteilbarkeit in vermutete Originalzitate und nachgeahmte Dialogbissen.
Zweitens wirkt das knapp 250 Seiten starke Buch seltsam leer, die Seiten kaum bedruckt, die Kapitel kurz, was einen nicht uninteressanten, aber letztlich ins Nichts führenden Gegenentwurf zur Überfülle von spätviktorianischer oder insgesamt Fin-de-Siècle-Literatur darstellt.
Und drittens die oben aufgeworfene Frage zum Nähe-Distanz-Verhältnis: Anders als bei beispielsweise Stuart O’Nans „Westlich des Sunset“ oder Michael Köhlmeiers „Zwei Herren am Strand“ bekommt die Leser:innenschaft bei „Das Bildnis des Oscar Wilde“ an den wenigsten Stellen wirklichen Einblick in den Kopf des Protagonisten. Sie sieht, was er tut und wie, und muss die Zerrissenheit doch aktiv in ihn hineinlesen, was bei Wildes belegter Fähigkeit zur Introspektion irritiert.
Es steht sich eben stets wacklig auf den Schultern von Giganten.
