„Lichtspiel“ von Daniel Kehlmann
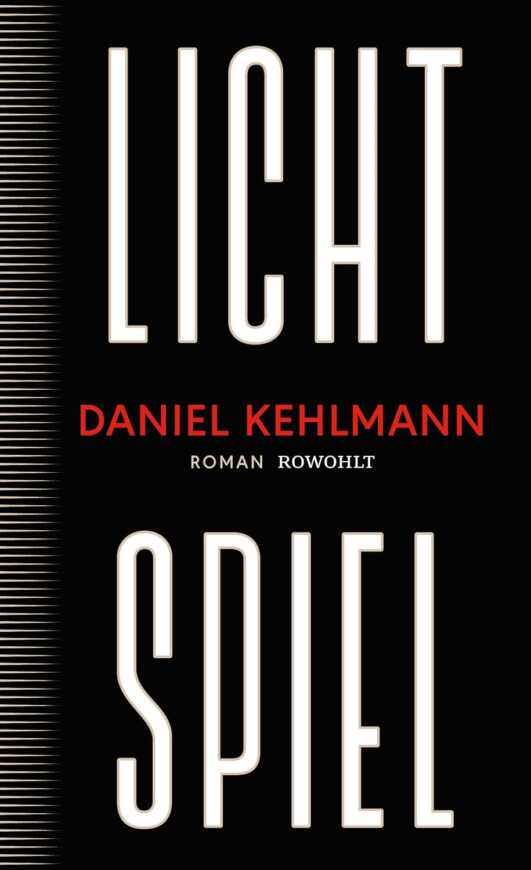
Mit seinem neuen Roman „Lichtspiel“ untersucht Daniel Kehlmann, welche Kompromisse man im Namen der Kunst eingehen darf.
Daniel Kehlmann ist routiniert im Umgang mit historischen Stoffen, doch mit „Lichtspiel“ nimmt er sich erstmals den Nationalsozialismus vor.
„Lichtspiel“ von Daniel Kehlmann ist unsere Buchempfehlung der Woche.
Er wird heute längst nicht so oft erwähnt wie Lang oder Murnau, aber jahrelang war der Regisseur G.W. Pabst einer der wichtigsten Regisseure des Weimarer Kinos, gilt als Entdecker von Greta Garbo und Louise Brooks. Wenn sein Name heute vergleichsweise selten fällt, hat das mit einer Mischung aus unglücklichen Zufällen und schlechten Entscheidungen zu tun. Daniel Kehlmann ist routiniert im Umgang mit historischen Stoffen, doch mit „Lichtspiel“ nimmt er sich erstmals den Nationalsozialismus vor – und dann gleich im Kontext der ewigen Debatte, ob die Kunst von der Politik und der Moral zu trennen ist. Natürlich ist die Antwort nein, aber unter Umständen können Angst, Naivität und schlichter Egoismus das vergessen machen. Und genau hier setzt Kehlmann an, wenn er seinem Protagonisten Pabst in den Abgrund folgt.
Eigentlich ist der schon früh nach Hollywood gegangen, wo er zwar ständig mit Lang verwechselt wird, aber immerhin Filme machen darf. Nur kommt er mit dem US-Studiosystem so gar nicht zurecht. Also kehrt er mit seiner Frau Trude und seinem Sohn Jakob nach Frankreich zurück, auch um seine angeblich kranke Mutter in Österreich zu besuchen – dann ist die Grenze plötzlich zu, und die Familie Pabst sitzt in der Falle. Während Trude in Verzweiflung versinkt und Jakob zum strammen Nazi erzogen wird, dreht Pabst für Goebbels und mit Riefenstahl Propagandafilme, bildet sich jedoch ein, seine Hände sauber halten zu können. Und wenn dann am Kriegsende für eine Massenszene die Statist:innen fehlen, ordnet man schon mal Hilfe aus dem nahen KZ an. Immerhin könnte der Film ein Meisterwerk werden …
Bei „Tyll“ war jeder Abschnitt eine eigene Erzählung, und auch in „Lichtbild“ ist jedes Kapitel gut und geschlossen genug, um auf eigenen Beinen zu stehen.
Besonders gefeiert wurde der Regisseur Pabst für seine Arbeit mit den Schauspieler:innen und seinen dynamischen Schnitt. Kehlmann erweist sich ebenfalls als Meister der Figuren und der Struktur: Wie schon bei seinem letzten Roman „Tyll“ schlüpft er mit jedem Kapitel in eine andere Perspektive, lässt mal Pabst sprechen, dann seine Frau, dann seinen Hausmeister, dann die Garbo. Bei „Tyll“ war jeder Abschnitt eine eigene Erzählung, und auch in „Lichtbild“ ist jedes Kapitel gut und geschlossen genug, um auf eigenen Beinen zu stehen – ohne dass Kehlmann den großen Bogen seines Romans opfern müsste.
In entscheidenden Momenten fragmentiert das Narrativ
In entscheidenden Momenten – wenn Pabst erstmals auf Goebbels trifft oder sein Assistent erkennt, wie weit er zu gehen bereit ist – fragmentiert das Narrativ, Dinge passieren in der falschen Reihenfolge oder mehrmals hintereinander. Hier, so suggeriert Kehlmann, sind selbst die Regeln von Raum und Zeit außer Kraft gesetzt – was es umso einfacher macht, auch alle Prinzipien in Frage zu stellen. So macht er alle Entscheidungen Pabsts menschlich nachvollziehbar, ohne sie zu entschuldigen. Denn dass es zuletzt weniger um Film oder Geschichte geht, sondern einfach um Schuld, macht nicht erst das Ende des Romans überdeutlich. Hier hat Pabsts Frau Trude das letzte Wort. Der neuste Film ihres Mannes mag ein Meisterwerk sein, gibt sie zu. Aber: „Ich habe eben nur genug von den Meisterwerken.“
Hat es Daniel Kehlmann mit „Lichtspiel“ auf unsere Liste der besten Bücher im Oktober 2023 geschafft?
