„Utopia Avenue“ von David Mitchell: Kaleidoskop in blass
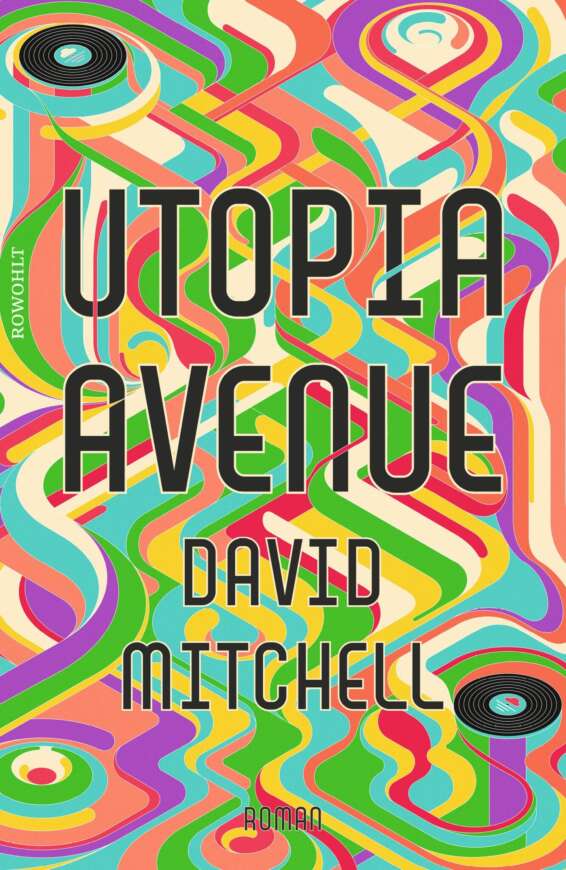
In „Utopia Avenue“ jagt David Mitchell eine fiktive Band durch die kunterbunten 60er – doch unter einem Wust aus Referenzen verliert er schon mal den roten Faden.
Eine Reise in die 60er mit David Mitchell, dem großen Fantasten und Musiknerd? Klingt wunderbar! Der Autor hat uns mitgenommen nach Japan um 1800, in eine ferne Zukunft und in eine Welt jenseits von Leben und Tod, und immer sind wir ihm gern gefolgt. Mit „Utopia Avenue“ nimmt sich David Mitchell die psychedelischste Dekade vor, in der Europa und die USA von endloser Aufbruchsstimmung beherrscht waren. Warum ist sein neuester Roman trotzdem sein erster, in dem der Funke nicht wirklich überspringen will?
Das Jahr ist 1967, in London stellt der amerikanische Manager Levon Frankland eine Band zusammen: Bassist Dean Moss ist ein typischer Rock-Macho, Folksängerin Elf Holloway leidet unter dem Patriarchat, Gitarrist Jasper de Zoet hat ganz eigene Probleme, und Drummer Griff Griffin ist irgendwie auch dabei, bleibt wie so viele Kollegen allerdings im Hintergrund. Gemeinsam haben die vier wenig, doch genau das sorgt für eine spannende Mischung – und nicht wenige zwischenmenschliche Spannungen. Nach holprigen Anfängen schaffen es Utopia Avenue in die Charts, später gar bis nach Kalifornien. Dabei wachsen Dean, Elf und Jasper als Personen, verlieben sich, bekommen Probleme mit dem Gesetz und begegnen einer endlosen Folge von Rocklegenden.
Alte Bekannte
Hier zeichnet sich das erste Problem mit „Utopia Avenue“ ab: Mitchells Hang, historische Personen zu Wort kommen zu lassen. Von John Lennon bis Janis Joplin, David Bowie bis Leonard Cohen (natürlich im Chelsea Hotel) – seine Charaktere treffen sie alle, tauschen zwei bedeutsame Sätze aus und verabschieden sich wieder. Und obwohl Mitchell normalerweise ein hervorragender Bauchredner ist, hat er sich hier übernommen: Nicht nur die vielen Zufälle irritieren, auch die Äußerungen der zahllosen Berühmtheiten klingen oft gezwungen. Der Gesamteffekt ist, ausgerechnet die überbordende Epoche, die Mitchell einfangen will, klein und überschaubar wirken zu lassen.
Ähnlich ermüdend können die vielen alten Bekannten sein. Nach und nach hat Mitchell seine Romane zu einem Multiversum zusammengeschweißt, das nicht nur mit wiederkehrenden Figuren bevölkert ist, sondern auch von einer übernatürlichen Kosmologie gestützt wird. Fans werden bei Jaspers Namen aufgehört haben: Natürlich ist der sozial überforderte Gitarrist ein Nachfahre des Protagonisten von „Die tausend Herbste von Jacob de Zoet“. Von dem hat er nicht nur den Namen geerbt, sondern auch ein ungewöhnliches Leiden, das genauer zu erklären einem Spoiler gleichkäme. Niemand, der mit Mitchells Werk vertraut ist, wird sich jedoch wundern, dass es über kurz oder lang ein Wiedersehen mit den Horologen gibt, einem Art Orden von Unsterblichen, die sich seit Jahrhunderten in einem Kampf mit bösen Seelenfressern befinden.
Schale Fantasy
Das Fantasy-Element war schon immer das kontroverseste in Mitchells Werk: In „Die Knochenuhren“ von 2016 steckte die diebische Freude, mit der der Autor die kurzen Menschenleben mit diesem kosmischen Krieg verwob, noch an, während „Slade House“ 2018 sich zu stark darauf konzentrierte. „Utopia Avenue“ rückt die Magie wieder an den Rand, lässt sie aber genau deshalb wie einen Nebengedanken erscheinen, den es schlicht nicht gebraucht hätte. Dasselbe gilt für die anderen Selbstreferenzen, die Mitchell nach Stephen-King-Manier einbaut: Crispin Hershey aus „Die Knochenuhren“ hat ebenso einen Auftritt wie Luisa Rey aus „Der Wolkenatlas“, Utopia Avenue sitzen in der Radiosendung von Bat Segundo aus Mitchells Debüt „Chaos“, und hätten sie es bis nach Japan geschafft, wären sie dort sicherlich dem Rabenvater von Eiji Miyake aus „Number 9 Dream“ begegnet.
Dabei verstellt das Mitchellversum bisweilen den Blick auf die Realität, die „Utopia Avenue“ ursprünglich inspiriert hat. Klar, Drogen und freie Liebe kommen nicht zu kurz, und auch Themen wie Homophobie berührt der Roman. Aber bis auf ein paar Straßenproteste gegen den Vietnamkrieg bleibt die politische und gesellschaftliche Seite des Jahrzehnts weitgehend unerforscht. Mitchell selbst ist als Jahrgang 1969 zu jung, um die Sixties bewusst erlebt zu haben – vielleicht tendiert er gerade deshalb zur Verklärung. Doch sein unerschütterlicher Glaube an die Macht dieses Jahrzehnts und seiner Musik klingt heute, wo deren Errungenschaften sich als weit zerbrechlicher erwiesen haben als erhofft, bisweilen erstaunlich naiv.
Fiktive Musik
Dazu gesellt sich ein handwerkliches Problem: Ich würde niemals behaupten, dass es unmöglich ist, über Musik zu schreiben – damit würde ich meinen eigenen Job als redundant erklären. Mitchells Liebe zur und enzyklopädisches Wissen über Musik sind seit „Chaos“ zentraler Teil seiner Bücher; zu fast allen könnte man problemlos eine Playlist zusammenstellen. Über fiktive Musik zu schreiben ist allerdings etwas ganz anderes, wenn auch ebenfalls nicht neu für Mitchell: Das „Cloud Atlas Sextett“ aus „Der Wolkenatlas“ hat diese Tradition begonnen, und sie lässt auch in „Utopia Avenue“ natürlich nicht lange auf sich warten.
Doch mehrere fiktive Alben zu erdichten, samt Lyrics, Instrumentierung und Wirkung, strapaziert dann doch die Grenzen des Machbaren. Songtexte ohne die zugehörige Musik wirken leicht lächerlich, das gilt umso mehr, wenn es gar keine Musik gibt. Und so ist der Sound von Utopia Avenue zugleich viel zu konkret – auch, weil Mitchell jeden Song auf einem wichtigen Event im Leben seiner Figuren basieren lässt und die Kapitel nach ihnen benennt – und frustrierend vage, weil er nicht existiert. Uns wird versprochen, dass die Band unglaublich eklektisch, aufregend und unnachahmlich klingt, doch vorstellen sollen wir uns das bitte selber. Und wie wir leider alle aus Erfahrung wissen: Je mehr jemand eine Band in den Himmel lobt, die wir noch nie gehört haben, desto weniger Interesse haben wir, sie auszuchecken. Wären Utopia Avenue eine richtige Band, wären ihre Alben wohl nur etwas für prätentiöse Nerds.
Am Ende bleibt der Kater
Das ist letztlich kein Beinbruch, denn „Utopia Avenue“ ist eben kein Album, sondern ein Roman. Und wenn diese Rezension dessen Probleme ins Zentrum gerückt hat, dann nur, weil sie von David Mitchells hohen Standards ausgegangen ist. Die sollen hier zuletzt noch einmal lobende Erwähnung finden: Von Wort zu Wort, Satz zu Satz, Szene zu Szene ist Mitchell noch immer ein Meister des literarischen Flusses. Er wirft Sätze wie im Vorbeigehen hin, für die andere Autor:innen ihre Seele verkaufen würden. Er kann das Alltägliche magisch erscheinen lassen und das Magische plausibel. „Utopia Avenue“ kann man an zwei Tagen durchlesen, so mitreißend ist die Geschichte, so bunt das Panorama. Einen psychedelischen Trip will Mitchell uns bescheren, und immer wieder schafft er das auch. Am Ende bleibt nur leider zu wenig zurück – außer einem leichten Kater.
