„Dream Count“ von Chimamanda Ngozi Adichie
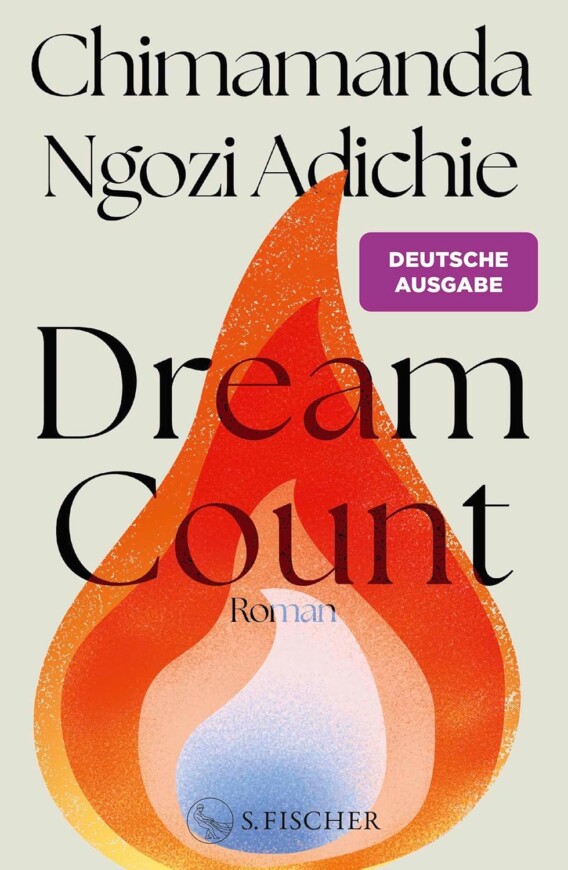
Ist „Dream Count“ von Chimamanda Ngozi Adichie denn nun das große Meisterwerk, auf das wir seit zwölf Jahren warten?
Was sollte nach „Americanah“ kommen? Chimamanda Ngozi Adichie hat seit ihrem Weltbestseller aus dem Jahr 2013 vieles gemacht: Die Tochter eines Statistikprofessors und der ersten Universitätsrektorin Nigerias hat über Kindererziehung und den Tod ihrer Eltern geschrieben, sie hat mit Angela Merkel über Feminismus diskutiert, und selbst Beyoncé hat Passagen aus einer von Adichies Reden gesampelt, um sie in den Song „Flawless“ einzubauen. Nur einen neuen Roman hat die 47-Jährige vermieden, und mit jedem verstreichenden Tag wurde der Erwartungsdruck größer: Ein neues Werk wird als Statement der derzeit wohl wichtigsten feministischen Autorin und afrikanischen Kulturvermittlerin gelesen werden.
Jetzt liegt „Dream Count“ vor, und Adichie erzählt in dem mehr als 500 Seiten starken Roman von vier Frauen, die einander in Freundschaft und Solidarität, aber auch in Neid und Konkurrenzdenken verbunden sind. Da ist Chiamaka, die aus einer wohlhabenden nigerianischen Familie stammt und als bislang mäßig erfolgreiche Reiseschriftstellerin in den USA lebt. Sie nutzt den Lockdown während der Pandemie, um über ihre gescheiterten Beziehungen nachzudenken. Chias beste Freundin Zikora arbeitet als erfolgreiche Anwältin in Washington, doch das Privatleben kann mit der Bilderbuchkarriere nicht mithalten: Jahrelang hat sie sich ein Kind gewünscht, aber als der Wunsch endlich in Erfüllung geht, verlässt sie der vermeintliche Traummann, als er von der Schwangerschaft erfährt.
Chias Cousine Omelogor verdient in der nigerianischen Hauptstadt Abuja durch zwielichtige Geschäfte unfassbar viel Geld, doch wegen ihres schlechten Gewissens kündigt sie schließlich bei der Bank, um in den USA ein Studienprojekt zum Thema Pornografie zu beginnen. Eine Ausnahme macht die aus Guinea stammende Kadiatou, die als einzige Figur nicht über eine privilegierte Biografie verfügt. Weil sie als Kind beschnitten wurde, beantragt sie in den USA Asyl, um ihrer Tochter dieses Schicksal zu ersparen, und arbeitet schließlich als Hausangestellte von Chia. Mit Kadiatou greift Adichie die Affäre um den IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn aus dem Jahr 2011 auf und fiktionalisiert sie: Als Zimmermädchen wird Kadiatou von einem sehr einflussreichen Mann in dessen Hotelsuite vergewaltigt.
Warum wird „Dream Count“ von Chimamanda Ngozi Adichie bislang eher gespalten aufgenommen?
Nun wird „Dream Count“ von der Kritik bislang eher gespalten aufgenommen: Neben Vergleichen mit „Sex and the City“ ist da gar von Oldschool-Feminismus und Kalendersprüchen die Rede. Tatsächlich aber ist genau das die große Leistung von Chimamanda Ngozi Adichie: Leicht und unterhaltsam lesbar verhandelt sie Abtreibungen, Fehlgeburten, sexuelle Gewalt und Genitalverstümmelung, ohne diesen Themen die Komplexität und Schwere zu nehmen und sich ausschließlich in Anklagen zu verlieren.
Immer wieder verlässt sie den Plauderton, um an komplexe Sachverhalte näher ranzuzoomen, tiefenscharfe Psychogramme zu erstellen und durchaus auch kontroverse Haltungen zur Diskussion zu stellen. Doch es sind die Alltagsgespräche ihrer vier Protagonistinnen, die ganz persönliche Widersprüche und Schwächen offenbaren. Würden sie fehlen, wäre „Dream Count“ nicht der große und entlarvende Roman, auf den wir zwölf Jahre lang gewartet haben.
