Keine Angst vor Experimenten: Die Alben der Woche

Gleich mehrere neue Alben finden in dieser Woche die sonst so schwer erreichbare Balance zwischen Schönheit und Sperrigkeit.
Was ist besser – Musik, die möglichst zugänglich und eingängig ist, oder Musik, die auch mal Experimente wagt? Bekanntlich gehen die Meinungen bei dieser Frage weit auseinander. Wo sich die meisten allerdings einig sind: Am besten ist Musik, die beides kombiniert. Und das gilt für gleich mehrere Alben, die diese Woche neu erscheinen. Im Zusammenschweißen von Sperrigkeit und Schönheit sind Xiu Xiu schon seit langem Meister. Mit der neuen Platte „Oh no“ legt Mastermind Jamie Stewart seine Misanthropie ab, denn alle Songs sind Duette. Als Gäste sind etwa Chelsea Wolfe, Sharon von Etten oder Owen Pallett zu hören.
Anstrengend hätte auch „Promises“ ausfallen können, das gemeinsame Projekt von Floating Points und Jazzsaxofonist Pharoah Sanders. Doch die Komposition auf Albumlänge überrascht vielmehr mit ihrem leichten, organischen Klang. Auch von den Antlers ist man spätestens seit „Hospice“ schwerste Kost gewohnt. Doch die neue Platte „Green to Gold“ klingt erstaunlich versöhnlich – für ein paar Tränen reicht es aber immer noch. Auch Noga Erez hat bekanntlich keine Angst vor radikalen Ideen. Das wird auf „KIDS“ sogar noch deutlicher als auf ihrem Erstling. Wem das alles dann doch etwas zu sperrig wird, kann mit Pudeldame ein paar Tanzschritte wagen. Die Alben der Woche:
 Xiu Xiu: Oh No
Xiu Xiu: Oh No
Seit vielen Jahren verstecken sie ganz große Popmomente hinter verzerrten Gitarren und an den Nerven sägender Elektronik. Und weil Xiu Xiu nun ein Dutzend Veröffentlichungen vollbracht haben, gönnt sich die kalifornische Band ein Album voller Duette. Für Mastermind Jamie Stewart ist das durchaus auch mit einem therapeutischen Effekt verbunden: „Unsere Gäste haben mir gezeigt, dass das Verhältnis von schönen zu beschissenen Menschen bei 60/40 liegt, und nicht, wie ich immer geglaubt habe, bei 1/99.“
Wirkliche Ausreißer stehen allerdings nicht auf der Gästeliste: am ehesten noch George Lewis Jr. alias Twin Shadow – doch auch den holen sie mit der angeschrägten Pathoshymne „Saint Dymphna“ auf die dunkle Seite. Wie erwartet sind „Sad Mezcalita“ mit Sharon Van Etten und „I dream of someone else entirely“ mit Owen Pallett matches made in hell. Und dann ist ist da auch noch diese großartige Coverversion von „One Hundred Years“: Im Verbund mit Chelsea Wolfe vervielfachen Xiu Xiu die abgründige Dringlichkeit des Cure-Klassikers.
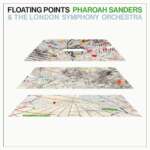 Floating Points, Pharoah Sanders, The London Symphony Orchestra: Promises
Floating Points, Pharoah Sanders, The London Symphony Orchestra: Promises
Ein kurzes, fragendes Motiv aus sieben Noten ist das erste, was wir hören. Es kehrt immer wieder, zieht sich wie ein Puls durch das neue Album von Floating Points und Pharoah Sanders. In Wahrheit ist „Promises“ allerdings eine lange Komposition, die neun Teile gehen nahtlos ineinander über. Fünf Jahre haben Sam Shepherd alias Floating Points, bekannt für seine elektronischen Jazzcollagen, und Saxofon-Legende Sanders daran getüftelt.
Herausgekommen ist ein Stück, das den uneindeutigen Charakter der Anfangsfigur aufgreift und über 47 Minuten in der Schwebe hält. Obwohl auch das London Symphony Orchestra mit ein paar Streichern zu hören ist, vermeidet „Promises“ die gängigen Neoklassik-Klischees, indem sich – außer besagtem Motiv – fast nichts wiederholt. Stattdessen ergänzen Sanders’ Improvisationen und Shepherds ausgeklügelte Klangteppiche sich zu einem erstaunlich organisch klingenden Ganzen: Wenn „Parallels“ in der Mitte zu einem schwelgerischen Höhepunkt anschwillt, fühlt es sich fast an wie ein lebendes, atmendes Wesen.
 The Antlers: Green to Gold
The Antlers: Green to Gold
Mit „Hospice“ aus dem Jahr 2009 haben The Antlers die wohl traurigste Platte aller Zeiten veröffentlicht, und auch nach dem Konzeptalbum über Tod und Verlust ging es in den Texten von Sänger Peter Silberman ans Eingemachte – wurde aber vom immer erhabeneren Songwriting und unwiderstehlichen Melodien abgemildert. Wie übergroß wird nun also das Drama, wenn die New Yorker Band nach sieben Jahren zurückkehrt und Silberman in dieser Zeit mit einem schweren Hörsturz, Stimmproblemen und Schreibblockaden zu kämpfen hatte?
Tatsächlich ist „Green to Gold“ aber eine Aussöhnung, die die Schwere der Vergangenheit nicht leugnet und all jenen Hörer*innen einen optimistischen Blick nach vorn anbietet, die auch nach mehr als zehn Jahren noch den Schmerz von „Hospice“ fürchten. Sicher, es braucht den Mut des Älterwerdens, um sich bei „Just one Sec“ und „It is what it is“ an Americana anzulehnen oder den sanft groovenden Lauf der Jahreszeiten im siebenminütigen Titelstück zu verfolgen. Und ganz ohne Tränen geht es auch nicht – ganz besonders dann, wenn sich Silberman in „Solstice“ an einen unbeschwerten Sommer seiner Jugend erinnert.
 Noga Erez: KIDS
Noga Erez: KIDS
Im Jahr 2017 tauchte die Produzentin, Sängerin und Rapperin aus Tel Aviv erstmals auf dem Radar auf und thematisierte mit ihrem Debüt den Krieg und die Konflikte ihrer Heimat. Noga Erez deutete einen ganz und gar eigenen Sound zwischen Contemporary Pop, HipHop und sperriger Elektronik an – nur hatte sie sich bei „Off the Radar“ noch zu sehr auf Übersongs wie „Dance while you shoot“ verlassen.
Auf „KIDS“ ist die 31-Jährige mutiger, formuliert Ideen radikaler aus – und kommt bei einem Album voller Stand-out-Tracks an. Mit toxischen Beziehungen und Depression sind die Songs vermeintlich privater, und vielleicht hat ja auch ihre Mutter geholfen, die per Sample fordert: „Can we get more sub so he can feel it?“ Zudem ist „KIDS“ auch Lockdown-kompatibel: „I don’t know what really, really happens at the End of the Road“, sprechsingt Erez – und wir tanzen zu diesem niederschmetternden Eingeständnis.
 Pudeldame: Kinder ohne Freunde
Pudeldame: Kinder ohne Freunde
Da zieht sich einem ja alles zusammen: Pudeldame. Ein Quartett aus Hamburg und Lübeck, das sich ironiekompatibel hipsterig kleidet und Musik zwischen Neuer Deutscher Welle und Indiepop macht. Erschwerend kommt hinzu, dass Schauspieler Jonas Nay als Sänger einen Starstunt suggeriert. Es ist leicht, Pudeldame und ihr Debütalbum „Kinder ohne Freunde“ ungehört beiseite zu wischen. Sollte man aber nicht: Sie sind zwangloser und laden mehr als all die anderen Neoschlagerprotagonist*innen zum Tanzen ein. „Bei unserer Musik muss etwas mit meinen Muskeln passieren“, sagt Nay selbst dazu, „es muss eine körperliche Reaktion geben.“ Vielleicht ist es daher auch gewollt, dass sich einem erstmal alles zusammenzieht.
